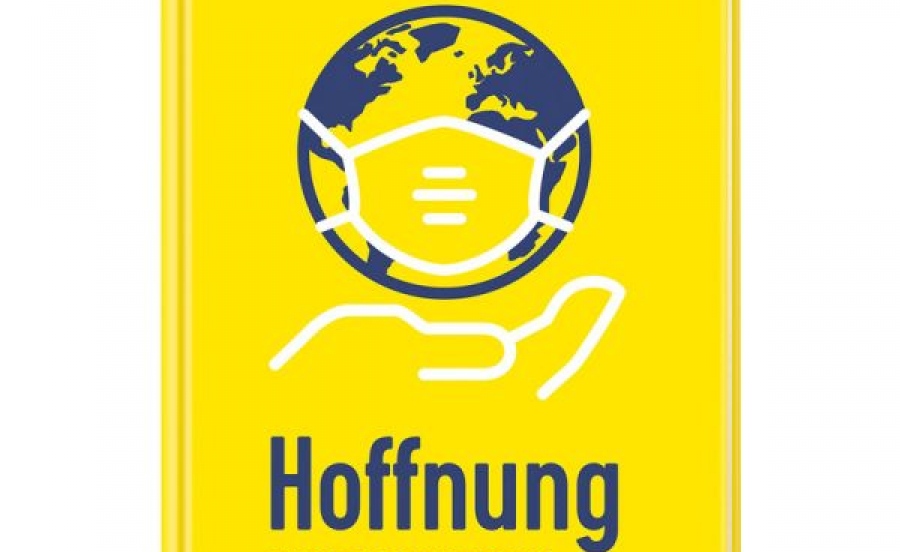Auf einmal ausgebremst
Ich bin Jana, 21 Jahre alt. Mein Leben teilt sich auf zwischen Montag bis Freitag und dem Wochenende, zwischen Schreibtisch und Bühne. Ich studiere Medizin, bin Rednerin und Influencerin. Der grösste Luxus meines Lebens ist Zeit.
Bis zum 26. Februar ging meine Famulatur im Krankenhaus, vom 27. bis zum 29. Februar sollte ich auf dem Willow Creek Leitungskongress in Karlsruhe sein, am 1. März wollte ich für sechs Tage in den Urlaub fliegen, um dann am 7. März auf einem Frauenevent zu predigen. In der Woche darauf sollte ich am Donnerstag nach Zürich fliegen für Dreharbeiten, Freitagabend in Winterthur sprechen und am Samstagmorgen nach Frankfurt zurückfliegen, um in Marburg auf einem Event zu sprechen. So weit meine Pläne.
Alles anders
Aber dann kam alles anders: Der Kongress wurde aufgrund der Corona-Infektion eines Sprechers abgebrochen, die Referenten mussten für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dort befinde ich mich bis heute – sieben Wochen später. Ich bin krank geworden und wurde positiv auf Covid-19 getestet. Auf einmal war alles anders. Die Krankheit zwingt mich zum Anhalten. Obwohl es mir mittlerweile wieder gut geht, sind alle Veranstaltungen abgesagt, alle Pläne nichtig. Und das nicht nur in meinem kleinen Kosmos. Die C-Problematik ist eine globale, die jeden betrifft. Eine «höhere Gewalt» scheint schuld zu sein.
Ein bisschen kommt es mir vor, als sei «beschäftigt sein» das neue «heilig». Wir sind alle so beschäftigt. Und wichtig. Wir sagen, unsere Priorität seien Beziehungen, aber wir kommen abends zu erschöpft nach Hause, um noch lebendig in diesen zu leben. Falls wir beten, sind unsere Gebete häufig erfüllt von unseren Anliegen und enden mit dem «Amen», bevor wir Gott überhaupt die Chance gegeben haben, zu antworten. Aber erfordert ein Gespräch nicht die Bereitschaft, zuzuhören?
Wenn plötzlich alles wegfällt, alle Termine, alle Arbeit, alle gewohnte Struktur, was macht man denn dann? Was mache ich denn jetzt? Und wer bin ich dann eigentlich?
Der Tag danach
In so einer langen Zeit der Quarantäne erlebt man Phasen. Meine erste war die von Trauer und Wut: Warum ich, warum jetzt, wie unfair! Während ich mich zunächst nur darüber aufgeregt habe, 14 Tage angeblich unnötigerweise in Quarantäne zu verbringen, hatte ich schon bald ganz andere Sorgen. Ich schreibe diesen Text an Tag 49 der Quarantäne, einige Wochen und mehrfache positive Testungen später. Immer und immer wieder wurde ich getestet und stets war ich positiv. Ich weiss, dass ich grundsätzlich ein positiver Mensch bin, aber das war dann doch zu viel des Guten…!
Bei der ersten Rückmeldung, die mir eröffnete, dass ich weitere zwei Wochen zu Hause bleiben müsse, war mein Tiefpunkt erreicht: Ich weinte, klagte, rang mit Gott. Nachdem meine Tränen getrocknet waren, raffte ich mich auf und führte mir selbst vor Augen, dass es genug Gründe gibt, dankbar zu sein. Und so schrieb ich eine Dankbarkeitsliste. Wer kennt diesen kläglichen Versuch nicht, «einfach mal die Perspektive zu ändern» oder «einfach mal das Positive zu sehen». Dann wartete ich weitere 14 Tage und machte Pläne für den Tag danach. Es gab so viel zu tun, zu erledigen, zu organisieren, umzuplanen. Und ich hoffte. Ich hoffte wirklich. Auf Freiheit, auf die Möglichkeit, Veranstaltungen wahrzunehmen, auf Besserung. Ich hoffte, dass irgendeiner meiner Pläne bald aufgehen würde. Ich hoffte. Und wartete.
Aber der Tag danach wollte einfach nicht kommen. Mir schien, solange ich mit meinen eigenen Plänen zu Gott kam, solange würde dieser Test positiv sein. Eine Sackgasse. Und so langsam dämmerte es mir: Meine Haltung musste sich verändern. Wenn ich weiterhin meine Zeit damit zubrachte, alles unfair zu finden, und meine Energie da rein investierte, Gott nach dem Warum zu fragen, dann würde ich am Ende in die Freiheit gehen und kein Stück freier sein. Ich sage immer: Jeder Mensch hat seine Bühne, dort, wo er ist. Bei mir ist das meistens tatsächlich eine richtige Bühne. Aber selbst in Momenten wie diesen habe ich eine Bühne. Und Verantwortung, diese zu bespielen.
«Von hier kommt mein Licht»
Über meine Plattform auf den sozialen Medien begann ich, von meiner Erkrankung, von den Herausforderungen, den Krisen und deren Überwinden zu erzählen. Da durfte ich erleben, dass Menschen sich angesprochen gefühlt haben, denn uns geht es doch gerade allen ähnlich. Wir zweifeln, wir haben Angst, wir sind unsicher. Und wir suchen Antworten. Ich bin nicht hier, um zu sagen: «Das ist meine Dunkelheit», sondern um gerade darin zu zeigen: «Von hier kommt mein Licht!»
Kürzlich telefonierte ich mit Freunden und wurde ermutigt: «Jana, deine Bühne ist vielleicht gerade klein – du sitzt einfach nur zu Hause – aber deine Zuhörerschaft ist gross. Unterschätze das nicht.»
Die Ruhe Gottes
So oft hören wir vom Aussäen und Ernten, aber dass in diesem kleinen Wörtchen «und» Monate, Jahre, viele Momente liegen, dass zwischen dem Aussäen von Samen und dem Sichtbarwerden von Früchten Zeit und Wachstumsprozesse ablaufen, das müssen wir uns wieder bewusst machen.
Wie so oft bleibt eines wahr: Je schneller ich kapituliere, desto eher kann Gott mit mir weitermachen. Wenn ich ankomme in meinen Umständen, kann ich meinen Blick über sie hinwegheben und auf Gott richten. Ich kann ihn fragen: Herr, was willst du mir sagen? Ich habe Zeit, ich höre zu.
Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort und wahr ist. Der Hebräerbrief erzählt mir deutlich, dass es eine Ruhe Gottes gibt und ich eingeladen bin, dort anzukommen. Die Ruhe Gottes war meinem ereignisreichen Leben bisher eher fremd. Wen der Teufel nicht stoppen kann, den treibt er an. Beides – Resignation und Übereifer – entfernen uns von dem, wozu wir eigentlich gerufen sind: dem Sein in der Gegenwart Gottes.
Einfach «sein» klingt so pathetisch und löste in mir bisher immer ein Augenrollen aus. Bis mir der Gedanke kam, dass es mich aufregt, weil es mir schwerfällt. In Stille alleine sein konfrontiert uns mit dem, was eigentlich in uns ist. Doch weil wir das nicht sehen und nicht fühlen wollen, sind wir lieber weg. Unterwegs, im Smartphone, beschäftigt.
Lebensanalyse
Ich glaube, dieses Anhalten der Welt kann Gott wie eine Notbremse nutzen. Eine Gelegenheit, um anzukommen. Was ist eigentlich wichtig? Wie lebt meine Gottesbeziehung, wenn ich nicht jeden Sonntag Input bekomme? Wie lebt sich Gemeinschaft in Zeiten von physischer Distanz? Und wie reagieren wir als Christen, auch in dem, was wir öffentlich weitergeben? Diese Umstände zwingen dazu, existenzielle Fragen neu zu stellen und vielleicht erstmalig mit Taten zu beantworten, anstatt nur mit Worten.
Ich könnte behaupten: In dieser Fastenzeit habe ich darauf verzichtet, meine vier Wände zu verlassen. Ganz schön radikal, oder? Das wäre genauso, als würde jemand mit einer Nussallergie sagen: «In dieser Fastenzeit habe ich kein Nutella gegessen. Ganz schön stark, oder?» Nein, nicht wirklich. Denn die Umstände zwingen dich dazu. Das ist keine innere Leistung, sondern eine äussere Beschränkung. Worauf habe ich also gefastet, wenn nicht auf das simple Rausgehen? Womit habe ich diese Wochen verbracht?
Unendliches Lob statt «Warum ich?»
Mehrere Tage habe ich über diese Fragen nachgedacht, bis ich zur Erkenntnis kam: Ich habe aufgehört, Gott aufzufordern, sich vor mir zu rechtfertigen. Ich habe aufgehört, mit Händen in die Hüfte gestemmt und vor Empörung schnaubend vor meinen Gott zu kommen und ihm mein «Warum?» entgegenzuschmettern. Der Producer meines YouTube-Kanals hat mir einmal in einem Video die Frage gestellt: «Wenn Gott dir gegenüberstünde und du hättest eine Frage frei, was würdest du fragen?» Das hat mich herausgefordert. Was würde ich diesen Gott fragen? Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe, was mir einfach wehgetan hat und worin ich im akuten Schmerz keinen Zweck gesehen habe. Aber würde ich meine eine Frage wirklich auf ein «Warum?» verwenden? Ist das wirklich so relevant? Das höchste der Gefühle wäre, dass er es mir erklärt, mir beweist, wozu er mich die ganze Zeit auffordert, es ihm im Vertrauen zu glauben: dass er einen Plan hat! Einen guten Plan! Was könnte ich darauf schon entgegnen? Nein, an dem Tag, an dem ich vor Gott stehen werde, wird kein «Warum?», kein «Warum ich?» mehr von Bedeutung sein. Wenn ich in diesem Moment nicht vor Ehrfurcht verstumme und auf die Knie falle, dann wird das einzige, was aus meinem Mund herauskommt, unendliches Lob sein. Ich habe dann keine Fragen mehr an einen Gott, der selbst die Antwort ist. Ich will alles aus seiner Hand annehmen. Alles.
Und so erlebte ich, dass sich mit jeder neuen «positiven Meldung» mein Herz veränderte: Ja, Gott, ich wünsche mir, hier rauszukommen, aber solange das nicht geht, glaube ich, dass du mir noch was sagen möchtest, dass du noch was vorhast. Ich hoffe nicht mehr auf das Aufgehen meiner Pläne. Ich vertraue auf dich, Gott.
Nein, Gott beantwortete meine Gebete nicht so, wie ich es erhofft hatte. Aber weil er nicht genauso antwortet wie erbeten, heisst das nicht, dass er die Bedürftigkeit dahinter nicht sieht. Denn das tut er. Er hat einen weiteren Plan, eine grössere Perspektive.
Sieben Wochen warten in der Wüste
Mein erstes YouTube-Video, das 2020 online ging, trägt den Titel «Ich in 10 Jahren» – was ich mir wünsche, worauf ich hoffe. Ich erzähle darin, dass man nur, wenn man wisse, wo man hinwolle, Schritte in diese richtige Richtung gehen könne. Und dass die Frage, wo man am Ende seines Lebens ankommen wolle, eine sei, die man sich heute stellen sollte. Ich erzähle, wie wichtig mir Beziehungen sind und dass kein geschriebenes Buch und kein absolviertes Examen der «Erfolg» seien, nach dem ich ultimativ strebe.
Aber mein ganzes Leben sah anders aus. Mein Terminkalender platzte. Bis alle meine Termine platzten und sieben Wochen Wüste begannen. Sieben Wochen «fasten», sieben Wochen Zeit zum Ankommen. Ich glaube, dass Gott uns manchmal ausgrätscht, damit wir erkennen, dass auf den Knien der exakt richtige Ort für uns ist.
Es war eine Zeit, in der ich Gott erwartet habe. Und zum Erwarten gehört das Warten. Ich bin überzeugt: Warten ist nicht passiv. Warten ist hochaktiv. Wie verbringen wir die Zeit in den Warteräumen, in den Backstagebereichen unseres Lebens? Sind wir frustriert, ungeduldig, wollen wir, dass es endlich losgeht, aber dann, wenn wir aufgerufen werden, merken wir, dass wir die Zeit nicht genutzt haben? Oder bereiten wir uns vor auf unseren curtain call? Ich möchte eine Frau sein, die bereit ist, wenn Gott sie weiter ruft.
Verändert
Sieben Wochen später und ich laufe befreit in die Freiheit. Ich bin verändert. Aus meiner Hoffnung wurde Zuversicht. Meine Lebenspriorität der Beziehungen – zu meinem Gott und meinen Mitmenschen – ist gerade in dieser Zeit der Isolation neu aufgelebt. Jeden Tag hatte ich Verabredungen zum Facetimen und lebte mehr Freundschaften als jemals zuvor. Physische Distanz muss uns nicht entfernen und das Alleinsein muss nicht einsam machen. Jeden Tag hatte ich auch mehr als genug Zeit für mein Gespräch mit Gott: Ein Gespräch, in dem ich nach dem «Amen» auch wirklich mal zuhöre.
Zur Autorin:
Jana Highholder ist Medizinstudentin, Influencerin und Sprecherin. Auch abseits von Bühne und Schreibtisch liebt sie Jesus und Gemeinschaft bei richtig gutem Kaffee. Sie hofft auf ̛ne nice Zukunft – mit Mann, Kindern, Doktortitel und einem doppelten Latte Macchiato.
Dieser Text erschien zuerst im Buch «Hoffnung –
Zuversicht in Zeiten von Corona» von Andreas Boppart.
Zum Thema:
Dossier: Hoffnung in der Krise
Glaube bekommt ein Gesicht: Jana, Jesus und Youtube
Sommer-Serie: Andrea Wegener: «Notstand ist normal»
Hoffnung in Corona-Zeiten: Viel mehr als ein «Warten auf Godot»
Datum: 19.07.2020
Autor: Jana Highholder
Quelle: Buch «Hoffnung – Zuversicht in Zeiten von Corona»