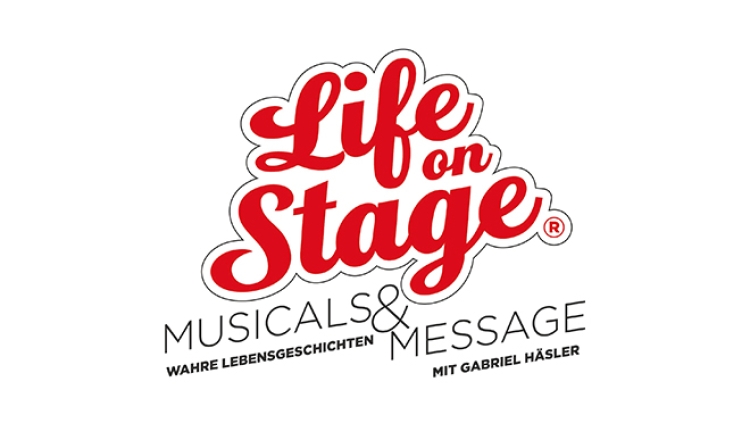Von Erinnerungskultur zu Gedenkarbeit
Erinnerungskultur ist wie ein Windrad: Theoretisch sinnvoll, aber praktisch störend, deshalb sollte sie bitte irgendwo anders stattfinden… Oder?
80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und kurz vor der nächsten Bundestagswahl in Deutschland geistert das Thema der Erinnerungskultur durch politische Debatten und auch kirchliche Erklärungen. Im Januar wurde in einem Festakt an den 80. Jahrestag zur Befreiung von Auschwitz gedacht. «Überlebende und Politiker gedenken der Opfer» titelte die Tagesschau. Bei zukünftigen runden Jahrestagen wird wohl nur noch von Politikern die Rede sein, denn die letzten Zeitzeugen sind bereits hochbetagt und werden nicht mehr lange leben. Kein Zweifel: Erinnerungskultur muss neu gedacht und gestaltet werden.
Viel mehr als die Schuldfrage
Erinnerungskultur geht auch in Deutschland weit über ein Schuldeingeständnis zum sogenannten Dritten Reich hinaus. Sie steht allgemein für den Umgang einer Gesellschaft mit ihrer Geschichte. Der kann sich in unterschiedlichsten Formen äussern: vom Denkmal über Strassennamen bis hin zu Gesprächen und Begegnungen. Jeder dieser Blicke in die Vergangenheit soll dabei helfen, die Gegenwart besser zu verstehen und die Zukunft anders zu gestalten. Wenn dabei eine Holocaustüberlebende vor einer Schulklasse spricht, wird heute niemand beschuldigt – warum auch? Heutige Kinder und Jugendliche haben damals nichts verbrochen.
Gleichzeitig ist es wichtig, sich immer noch mit den Schrecken der NS-Zeit auseinanderzusetzen, um aus der Geschichte zu lernen. Wo das nicht geschieht, kommt es zu geschmacklosen Vergleichen wie dem von Alexander Gauland, der die NS-Zeit als «Vogelschiss der Geschichte» in Beziehung zur sonst «ruhmreichen» Vergangenheit Deutschlands bezeichnete. Doch Vergangenheit wird nicht ruhmreicher, wenn man Schuld bagatellisiert.
Heraus aus der Erinnerungskultur
Die Internet-Aktivistin Susanne Siegert möchte den Holocaust und seine Folgen in den sozialen Netzwerken sichtbar machen. Sie spricht dabei allerdings nicht von Erinnerungskultur. Bei deutschland.de erklärt sie, «dass man sich im Wortsinn ja eigentlich nur an etwas erinnern kann, das man persönlich erlebt hat» – und das trifft auf immer weniger Menschen zu. Sie bevorzugt deshalb den Begriff «Gedenkarbeit». Das Spannungsfeld zwischen Denken, Gedenken und Arbeiten fasst gut zusammen, dass sich Erinnerungskultur weder konservieren noch festhalten lässt, dass sie aber mit Aufwand verbunden ist. Sie muss in Bewegung bleiben. Sie darf und muss auch positive Aspekte der Geschichte betonen – ohne das auf Kosten der negativen Schlagseiten zu tun. Und sie muss Formen entwickeln, wie Menschen sich auch heute noch mit der Vergangenheit auseinandersetzen können. Ein gutes Beispiel sind die bekannten «Stolpersteine» des Künstlers Gunter Demnig, die darauf hinweisen, wo überall Menschen gelebt haben, die im Dritten Reich fliehen mussten, deportiert oder ermordet wurden.
Gedenken stört
Solch ein Gedenken «stört» den normalen Alltag. Dazu ist es auch da. Die Werbung bezeichnet einen Aufkleber mit der Information «jetzt billiger» als «Störer», denn er soll die normale Wahrnehmung durchbrechen. Spannenderweise ist schon in der Geschichte Gottes mit Israel von ähnlichen «Störern» zum Gedenken die Rede. Das sogenannte Bilderbuch der Bibel, das Alte Testament, ist voll davon. Ein Beispiel findet sich dort, wo die Israelis mit Josua in ihr «verheissenes Land» ziehen. Der Jordan scheint eine unüberwindliche Sperre für sie zu sein, doch als die Priester sich mit der Bundeslade ins Wasser begeben, bleibt dieses stehen und das Volk kann trockenen Fusses hinübergehen. Anschliessend erhalten zwölf Mann den Befehl, Steine aus dem Jordan zu holen und sie am Ufer aufzustapeln, «damit sie ein Zeichen unter euch seien». Die Begründung dafür lautet: «Wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden: ‘Was haben diese Steine für euch zu bedeuten?’, so sollt ihr ihnen sagen, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn abgeschnitten wurde; als sie durch den Jordan ging, sind die Wasser des Jordan abgeschnitten worden; so sollen diese Steine den Kindern Israels zu einem ewigen Gedenken dienen!»
Gedenken stört den Alltag. Aber Blicke in die Geschichte helfen nicht nur dabei zu verstehen, woher wir kommen, sondern auch zu gestalten, wohin wir gehen. Sie zeigen grosse und auch schuldhafte Elemente auf. Und wie bei Josua können sie helfen, auch Gottes Handeln in der Geschichte an kommende Generationen weiterzugeben.
Zum Thema:
Umgang mit traumatischer Vergangenheit: Vergessen oder vergeben?
Von Holocaust und Hoffnung: Gescheitert, erfolgreich und bis heute aktuell: Elie Wiesel
Ein besonderer Jahrestag: 30 Jahre Völkermord - 30 Jahre Versöhnung
Datum: 12.02.2025
Autor:
Hauke Burgarth
Quelle:
Livenet